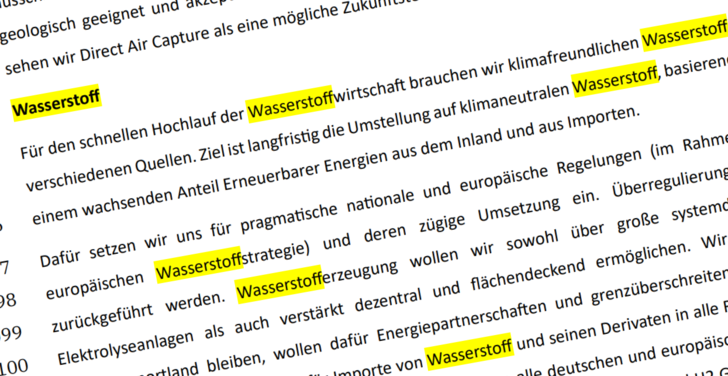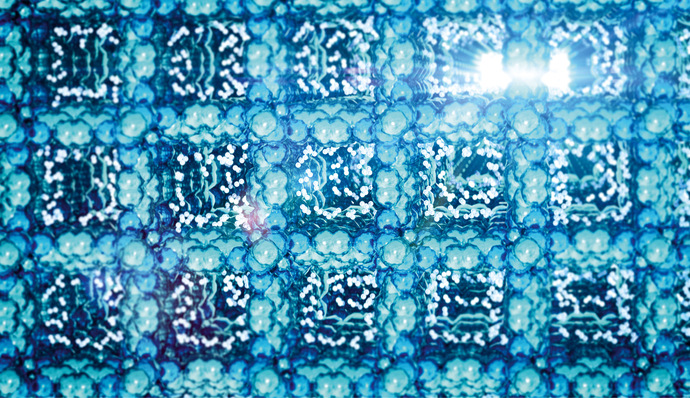Stattliche 146 Seiten beziehungsweise 400.000 Zeichen umfasst der am 9. April vorgestellte Koalitionsvertrag von CDU, CSU und SPD. Das Wasserstoff-Kapitel ist 2.000 Zeichen lang und steht auf Seite 36. Wer Zahlen mag, kann also sagen: Der Koalitionsvertrag enthält 0,5 % Wasserstoff im vorderen Drittel. Insgesamt 16 Mal kommt der Begriff Wasserstoff vor. Das ist eine gute Platzierung, aber nicht allzu viel Gehalt.
Das Wasserstoff-Kapitel im Bereich „Klima und Energie" gibt immerhin eine Richtung vor: mehr Tempo, weniger Details. Deutschland soll eine führende Rolle in einer europäischen Wasserstoffinitiative einnehmen, schreiben die Koalitionspartner in ihrer Vereinbarung. Allerdings versteckt sich dieser Satz in der Mitte des Absatzes.
Für den schnellen Hochlauf der Wasserstoffwirtschaft soll es „klimafreundlichen Wasserstoff aus verschiedenen Quellen" geben. Klimaneutral soll er erst langfristig werden, basierend auf einem wachsenden Anteil Erneuerbarer Energien aus dem Inland und aus Importen. Die Regeln dafür sollen sowohl in Deutschland als auch in Europa „pragmatisch" sein und im Rahmen der europäischen Wasserstoffstrategie liegen. Überregulierung müsse zurückgeführt werden, heißt es. Interessant ist auch das sowohl - als auch bei der Erzeugung. Diese soll einerseits in „großen systemdienlichen Elektrolyseanlagen" stattfinden, andererseits „verstärkt dezentral und flächendeckend". Hierin kann man eine Verschiebung zu kleinen Anlagen sehen, bei denen die Einbindung ins Gesamtsystem womöglich als weniger wichtig gilt.
Die Koalitionspartner betonen, dass Deutschland ein Energieimportland bleiben wird. Sie wollen daher Energiepartnerschaften ausbauen und für die nötige Importinfrastruktur für Wasserstoff uns seine Derivate sorgen, und zwar „in alle Richtungen". Das soll auch eine Anbindung an „alle deutschen und europäischen Häfen" umfassen. Wie genau das Wort „alle" zu verstehen ist und ob es zum Ziel oder zum Verzetteln führt, werden die nächsten Monate zeigen.
Die Infos über Förderung bleiben dünn
Spannend ist die Frage, welche Mittel bei diesen Schritten helfen sollen. Die Koalitionspartner einigten sich, nationale und europäische Förderinstrumente zu nutzen. Genannt sind Beispiel H2 Global, IPCEI-Projekte (Important Projects of Common European Interest) und „spezifische Programme für den Mittelstand". Das ist nicht allzu viel bei näherer Betrachtung. Bei H2 Global geht es um Abnahmegarantien für Importe von grünem Wasserstoff, vor allem aus Entwicklungs- und Schwellenländern. Das EU-Programm IPCEI ist genau genommen nur eine Erlaubnis an die Mitgliedsstaaten, wichtige Projekte über die strengen Beihilfevorgaben hinaus zu bezuschussen. Das Geld müssen die jeweiligen Länder selbst aufbringen, sofern sie nicht andere EU-Programme dafür anzapfen können. Wer in Deutschland Wasserstoff-Projekte umsetzen will, muss also auf die besagten Mittelstandsprogramme oder andere, nicht im Koalitionsvertrag genannte Ansätze hoffen.
Über die Zertifizierung klimafreundlicher Energieträger heißt es, diese solle zugleich „vertrauenswürdig" und „unbürokratisch" sein. Wie man diese gleichermaßen wichtigen Ansprüche vereinen könnte und an welche bestehenden Prozesse man andocken will, bleibt offen. Das Wasserstoffkernnetz soll die industriellen Zentren „bedarfsgerecht" anbinden, „auch im Süden und Osten Deutschlands" und mit Anbindung von Speichern. Die Koalitionspartner kündigen dafür zusätzliche Trassen an. Die Finanzierung müsse gewährleisten, dass das Kernnetz in einer integrierten Planung umgesetzt werde, heißt es. Ob das bedeutet, dass man das gerade erst aufgebaute System fortsetzen will oder ob daran gerüttelt wird, lässt sich dem Text nicht entnehmen. Zugleich soll schon mal der Aufbau eines Verteilnetzes beginnen.
Energiepolitik: Erstmal ein paar Monate monitoren
Das Kapitel Energiepolitik liefert womöglich eine Erklärung für die wenig konkreten Formulierungen im Wasserstoff-Kapitel. Darin kündigen die Koalitionspartner ein Monitoring an, das bis zur Sommerpause 2025 „den zu erwartenden Strombedarf sowie der Stand der Versorgungssicherheit, des Netzausbaus, des Ausbaus der Erneuerbaren Energien, der Digitalisierung und des Wasserstoffhochlaufs" überprüfen soll. Die Ergebnisse sollen dann die Grundlage der weiteren Arbeit sein.
Welche Daten das „Monitoring" innerhalb weniger Monate liefern soll, die nicht ohnehin schon vorhanden sind, steht nicht im Koalitionsvertrag. Man kann daher mutmaßen, dass vielleicht eher eine zusammenfassende Bestandsaufnahme gemeint ist, als ein Monitoring im eigentlichen Wortsinne.
Industrie: mehr blauer Wasserstoff
Neben dem Wasserstoff-Kapitel kommt das Stichwort Wasserstoff noch an weiteren Stellen vor, zum Beispiel unter der Überschrift „Industriestandort Deutschland stärken". „Wir werden den Aufbau einer Wasserstoffwirtschaft beschleunigen und pragmatischer ausgestalten. Im Hochlauf müssen wir alle Farben nutzen", heißt es dort. In diesem Kapitel zeigt sich auch, dass die Koalitionsparteien durchaus in der Lage sind, konkret zu formulieren. „Wir werden umgehend nach Beginn der Wahlperiode ein Gesetzespaket beschließen, das die Abscheidung und Speicherung von Kohlendioxid insbesondere für schwer vermeidbare Emissionen des Industriesektors und für Gaskraftwerke ermöglicht", versprechen sie.
Mobilität und Verkehr: Vergünstigungen wirklich nur noch für E-Fahrzeuge?
Auch in Bezug auf die Automobilindustrie haben die Parteien klare Vorstellungen und bereits eine Liste an Maßnahmen formuliert. Der Fokus liegt auf E-Mobilität, was zumindest für PKW wenig überraschen dürfte. Als Punkt 8 findet an letzter Stelle der Liste auch die „Förderung einer Wasserstoff-Ladeinfrastruktur für Nutzfahrzeuge." Emissionsfreie LKW sollen zudem über 2026 hinaus von der Maut befreit werden. Auffallend ist aber, dass es für E-Fahrzeuge darüber hinaus viele weitere Vergünstigungen geben soll: steuerliche Begünstigungen, Sonderabschreibungen und Freibeträge auf die KFZ-Steuer. Für Wasserstoff-Fahrzeuge ist keine dieser Vergünstigungen genannt — auch nicht mit dem Verweis auf lange Strecken oder große Lasten.
Forschung und Innovation: Wasserstoff für den Fusionsreaktor
Im Kapitel Forschung und Innovation taucht Wasserstoff erneut im Koalitionsvertrag auf. Die angehenden Regierungsparteien wollen eine „Hightech-Agenda" für Deutschland starten. Der Staat will dabei unter anderem als Ankerkunde agieren. Der Vergleich mit den anderen Schlüsseltechnologien hilft auch hier bei der Einordnung. Für die Förderung die Künstliche Intelligenz wird eine Gigafactory und ein Verbund von KI-Spitzenzentren angekündigt, in der Quantentechnologie soll es mindestens zwei Höchstleistungsrechner geben, in der Biotechnologie eine „Nationale Biobank" als Grundlage für Präventions-, Präzisions- und personalisierte Medizin. Wasserstoff folgt im Forschungskapitel erst im vorletzten Absatz, der mit „Fusion und klimaneutrale Energieerzeugung" überschrieben ist. Konkretes Ziel in diesem Absatz: den ersten Fusionsreaktor der Welt in Deutschland zu bauen. Dabei geht es immerhin auch um Wasserstoff, sozusagen.
Zum sechzehnten und letzten Mal findet sich der Begriff Wasserstoff im Kapitel „Europas Wettbewerbsfähigkeit und Wohlstand". Darin fordern die Koalitionspartner eine „echte Energieunion". Gemeint sind gemeinsame Netze und Märkte — einschließlich Wasserstoff.
Erste Reaktionen aus den Verbänden
Der Deutsche Verein des Gas- und Wasserfaches e.V. (DVGW) begrüßt, dass die Koalitionsparteien stärker auf die bestehende Gasnetz-Infrastruktur setzen. Der Verband lobt das Bekenntnis zum Wasserstoff-Kernnetz. Er sieht zudem noch einen anderen Vorteil für die Gas- und Wasserstoffbranche: die Abschaffung des Gebäudeenergiegesetzes (GEG) sowie eine vereinfachte kommunale Wärmeplanung könnten Heizen mit Wasserstoff attraktiver erscheinen lassen. Auch die Ausrichtung auf CCS könnte der Gas- und Wasserstoffbranche nutzen, so der Verband. Zum Thema Wasserstoff will sich der Verband noch detaillierter äußern.
Der Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft BDEW lobt die Kontinuität in der Energiepolitik. Kerstin Andreae, Vorsitzende der BDEW-Hauptgeschäftsführung, sagt: „Ein resilientes Energiesystem ist die Basis für Versorgungssicherheit und Wettbewerbsfähigkeit. Es fußt auf dem Ausbau erneuerbarer Energien, steuerbarer Kapazitäten auf Grundlage von Gas und perspektivisch Wasserstoff und dem wichtigen Fokus auf Infrastruktur und Flexibilitäten. Es ist daher ein gutes Signal, dass die Koalition keine Kehrtwende bei der Energiewende macht, sondern die energiepolitische Kontinuität und einen innovationsgetriebenen Kurs Deutschlands voranbringt."
Der Verband en2x aus der Mineralölwirtschaft sieht im Koalitionsvertrag in Sachen Wasserstoff „positive Ansätze“ und „erheblichen Nachsteuerungsbedarf“. Bezüglich der Bedeutung von Raffinerien und der Mineralölwirtschaft für die industrielle Wertschöpfung und resiliente Energieversorgung bleibe der Koalitionsvertrag hinter dem Notwendigen zurück. Der Verband betont die hohen Kosten für Energie und Emissionshandel sowie den globalen Wettbewerb, sieht Arbeitsplätze und Versorgungssicherheit in Gefahr. In Bezug auf Kraftstoffe im Straßenverkehr solle man zudem die Besteuerung nach Klimawirkung und Nachhaltigkeit variieren.