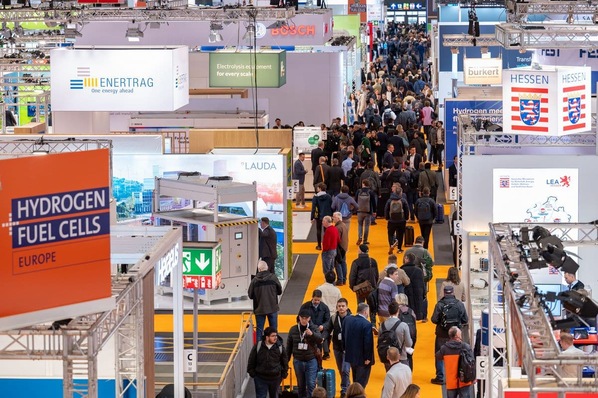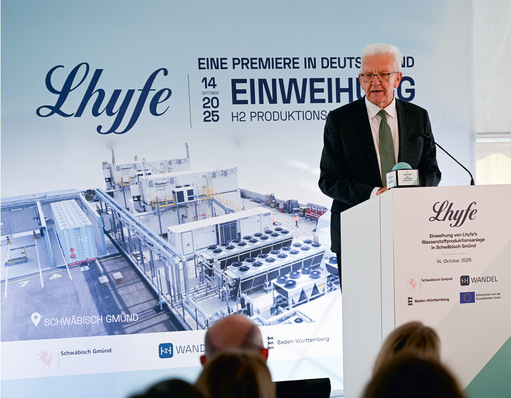„Es ist eine neue Lösung für einen neuen Markt”, sagt Vincent Designolle, der bei Vallourec für das Thema Wasserstoff verantwortlich ist. Die zugrunde liegende Herausforderung ist hingegen so alt wie die Welt: Die Sonne scheint nur tagsüber, der Wind weht mal mehr, mal weniger stark. Wer also grünen Wasserstoff erzeugen und nutzen will, muss sich auf diese Schwankungen einstellen. Doch Stahl- und Chemiewerke lassen sich nicht nach Wetterlage hoch und runterfahren. „Der Abnehmer will eine stabile Bereitstellung”, sagt Designolle. Um ein fluktuierendes Angebot für eine konstante Produktion zu nutzen, braucht man daher Speicher – und die müssen im Falle von Industriebetrieben ziemlich groß sein. Mit bis zu 100 Tonnen speicherbarem Wasserstoff kommt der Delphy in diese Größenordnung. Zum Vergleich: Der neue Großtrailer von Linde fasst 3,9 Tonnen Wasserstoff, der Kavernenspeicher Harsefeld in Norddeutschland soll 7.500 Tonnen beinhalten, der Tagesbedarf von Stahl- und Ammoniakwerken liegt im Bereich von einigen hundert Tonnen. Mit einem 100-Tonnen-Speicher kann ein kleineres Werk oder eines in einer frühen Ausbaustufe also gut durch die Nacht kommen. Ein anderer Kundenkreis sind große Tankstellen oder Betreiber von Back-up-Lösungen, zum Beispiel für Krankenhäuser oder Rechenzentren. Dabei geht es um einige Tonnen pro Tag.
Speicher machen flexibel
Jenseits der unbedingten Notwendigkeit ermöglichen die Speicher auch die Flexibilität, auf unterschiedliche Situationen am Strommarkt und im Netz zu reagieren. Das kann durchaus einen Unterschied machen, denn in vielen Ländern bedeutet Flexibilität einen Preisvorteil beim Stromeinkauf. In Deutschland setzen viele Betriebe darauf, Strom zu Niedriglastzeiten günstiger an der Strombörse einkaufen zu können. In Frankreich zahlt der Netzbetreiber einen Bonus, wenn Großkunden punktuell ihre Leistung reduzieren können. Und Saudi-Arabien hat drastische Unterschiede zwischen den Stromtarifen zu Hoch- und Niedriglastzeiten. Unterm Strich heißt das immer: Wer flexibel agieren kann, senkt seine Stromkosten – und damit den stärksten Kostentreiber in der Wasserstofferzeugung per Elektrolyse.
Sofern Industriebetriebe auf diese Situation reagieren, sind bisher vor allem mit Batteriespeicher die Technologie der Wahl. Diese puffern teure Leistungsspitzen ab und verlagern Lasten in Zeiten, zu denen der Strom günstig ist. Mit diesen muss sich also auch Vallourecs neuer Speicher Delphy messen lassen. Das hat der Hersteller durchgerechnet. Sein Ergebnis: in den kurzen Zeiträumen, zum Beispiel bei der 15-Minuten-Optimierung, punktet die Batterie. Doch je länger der zu überbrückende Zeitraum ist, umso mehr verschiebt sich die Kostenrechnung zu Gunsten des Delphy-Speichers. Wenn es darum geht, in einer Wasserstoff-Wertschöpfungskette die nächtliche Erzeugungslücke beim Solarstrom auszugleichen, habe er klar die Nase vorn, so der Hersteller, und zwar um einen zweistelligen Faktor.
Wird aus dem Wasserstoff allerdings wieder Strom erzeugt, verschiebt sich die Rechnung zugunsten der Batterie. Zudem bezieht sich der Vergleich der Einfachheit halber jeweils auf den CAPEX der Speicher. Die Systemkosten können abweichen. Zugunsten der Batterie würde man in vielen Anwendungsfällen einrechnen, dass diese einen durchgängigeren Betrieb des Elektrolyseurs ermöglichen würde, sodass dieser kleiner ausfallen kann. Zugunsten des Delphy-Speichers wirkt hingegen, dass man auch mit Batteriespeicher oft zusätzlich einen Wasserstoffspeicher einplanen würde, um mögliche Ausfälle zu überbrücken.
Platzsparend und sicher
Das Speicherdesign berücksichtigt zwei typische Bedingungen bei Industrieanlagen: ein knappes Platzangebot und strikte Sicherheitsvorschriften. In Bezug auf den Untergrund ist die Technologie recht flexibel, denn die Lösung ist modular und wird an die jeweiligen Verhältnisse angepasst.
„In Bezug auf den Untergrund gibt es nur wenige Showstopper. Es geht vor allem darum, die beste Kombination von Tiefe und Zahl der Röhren zu finden“, sagt Designolle. Das modulare Design und die anpassbare Länge der Zylinder machen den Speicher gut skalierbar. In 80 Zylindern lassen sich typischerweise 10 Tonnen Wasserstoff speichern. Ein hartes Limit gibt es nicht, doch bei einer zu hohen Zylinderzahl wird die Verrohrung irgendwann zu komplex.
Was den Tiefbau betrifft, setzt Vallourec auf die Schlitzwandbohrung in Kombination mit Erdaushub – ein bewährtes und platzsparendes Verfahren, mit dem unter anderem Lüftungsschächte für U-Bahnen in Innenstädten gebaut werden. Ein Betonring stützt dabei den äußeren Rand der Grube ab, während man im inneren Immer weiter in die Tiefe graben kann. Wer tief gräbt, muss natürlich mit steigenden Kosten rechnen. Allerdings gibt Vallourec zu bedenken, dass auch ein normaler Drucktank ein Fundament benötigt und beim Delphy-Konzept die Größe die spezifischen Kosten wiederum sinken. Alles in allem sei der CAPEX pro Speichermenge bei Delphy ähnlich wie bei Drucktanks an der Oberfläche, sagt Designolle. Allerdings punktet der Untergrundspeicher mit geringerem Platzbedarf und bei der Sicherheit. Das senkrechte unterirdische Design führt dazu, dass selbst bei einem Leck die austretende Wasserstoffwolke deutlich kleiner wäre. Sicherheitsabstände können daher geringer ausfallen – auch das spart Platz an der Erdoberfläche.
Das Pilotprojekt ist seit November 2023 im Betrieb, die Tests sind absolviert, die DNV-Zertifizierung seit Juni 2025 abgeschlossen. Nun kann die Kommerzialisierung beginnen. Absichtserklärungen (Memorandums of Understanding, MoUs) wurden bereits unterzeichnet: mit H2V für Projekte zur Produktion und Nutzung von grünem Wasserstoff sowie mit NextChem Tech für Anwendungen im Bereich grüner Wasserstoff und grüner Ammoniak. Mit weiteren Unternehmen sei man im Gespräch, sagt Designolle. Zwölf bis 18 Monate nach dem ersten Auftragseingang könnte dann der erste kommerzielle Untergrund-Röhrenspeicher in Betrieb gehen, schätzt Designolle. Dass es so lange dauert, liege vor allem an den Lieferzeiten für Komponenten, insbesondere die Druckbehälter, die Messtechnik und Automatisierung. Der eigentliche Tiefbau könnte auch schneller sein, heißt es. Rechnerisch könnte bei einem heute erteilten Auftrag also Ende 2026 ein Untergrund-Röhrenspeicher in Betrieb gehen. Soweit will sich Vallourec aber nicht aus dem Fenster lehnen. Man habe eine „Pipeline an Möglichkeiten“, heißt es nur.