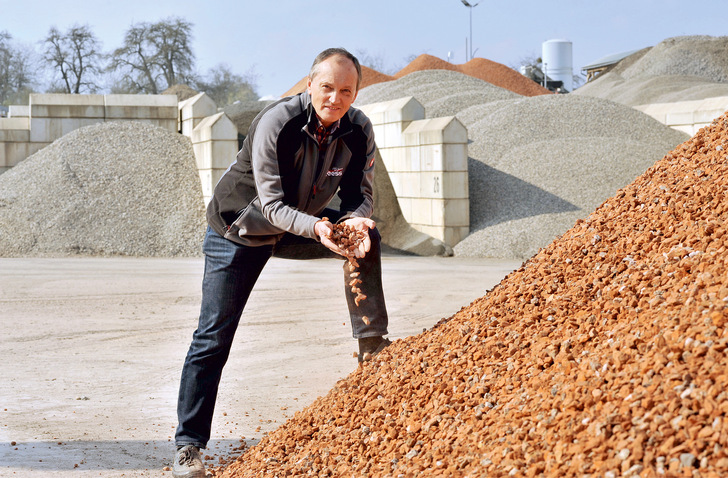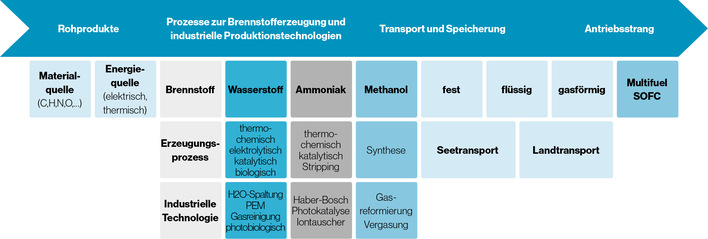In der Logistik läuft die Transformation hin zu zero-emission-vehicles (ZEV) auf Wasserstoffbasis. Bei den Baumaschinen begann die Veränderung später – nun ist sie ganz ins Stocken gekommen. Ein Grund sind die Kosten. Im Jahr 2024 kostete die kWh an der Ladestation für Elektrofahrzeuge 70 Cent, das Kilo Wasserstoff aber zehn bis 15 Euro. Damit ist Wasserstoff bezogen auf die nutzbare Energie etwa gleichauf mit Benzin, Strom hingegen deutlich günstiger.
Verfügbarkeit: gemeinsames Problem für Strom und Wasserstoff
Und dann muss man den Wasserstoff erstmal bekommen. „Vor allem wegen der fehlenden Verfügbarkeit ist das Thema Wasserstoff für uns noch ganz weit weg,“ sagt Sonja Reimann, Pressesprecherin beim Baumaschinen-Händler und Caterpillar-Vertriebspartner Zeppelin Baumaschinen. Aktuell würden Ankündigungen und geplante Investitionen in diesem Bereich wieder zurückgenommen. Eventuell werde Caterpillar 2028 auf der Bauma einen Proto-Typen präsentieren. Das Unternehmen fokussiere sich bislang im ZEV-Kontext auf batterieelektrische Antriebe für Großmaschinen wie Radlader mit 50 Tonnen.
Doch daraus ergibt sich eine andere Herausforderung: Die Stromversorgung auf Baustellen sei oft kritisch, so Reimann. Dennoch sei das Interesse auf Kundenseite an dieser Thematik erstaunlich hoch. Deshalb beobachte man diesen Markt, etwa welche Lösungen für die Ladeinfrastruktur auf den Baustellen diskutiert werden oder wie man generell die Stromversorgung auf mobilen Baustellen verbessere. Für diese Anwendungen wäre es grundsätzlich ein Vorteil, wenn Baumaschinen mit Wasserstoff betrieben und somit nicht zusätzlich die Stromversorgung belasten würden.

© FEESS
Wasserstoff-Konzepte bei Baumaschinen-Herstellern
Unternehmen und Forschungseinrichtungen widmen sich immerhin weiter der Entwicklung und Erprobung von wasserstoffbetriebenen Baumaschinen. So präsentierte Liebherr bereits 2022 auf der Bauma Prototypen von zwei Wasserstoff-Verbrennungsmotoren. Im Jahr 2024 folgte die Vorstellung des Prototypen des Radladers L566 H im Liebherr-Werk in Bischofshofen. Im Oktober des selben Jahres ging er in einem Steinbruch der Strabag in den Testbetrieb. Betankt wird er in einer eigens eingerichteten Tankstelle im Steinbruch. Von der ursprünglich für 2025 angekündigten Serienproduktion hörte man allerdings nichts mehr. Das verwundert nicht, da der Testbetrieb noch bis Oktober 2026 dauern soll.
Darüber hinaus lotet die Branche die Einsatzmöglichkeiten von Brennstoffzellen aus. Zum Beispiel arbeiten General Motors und der Baumaschinenhersteller Komatsu zusammen an einem Wasserstoff-Brennstoffzellen-Modul für einen elektrischen Muldenkipper, war bei der diesjährigen Bauma zu erfahren. Außerdem hat Komatsu als Konzeptmaschine einen mittelgroßen Hydraulikbagger mit Wasserstoff-Brennstoffzellen-System entwickelt.
Dass genug Druck auf dem Innovationskessel bleib, dafür sorgen Firmen wie die Strabag SE, eines der größten Bauunternehmen Europas. Das Österreicher Unternehmen, zudem auch die Züblin in Stuttgart gehört, will in seiner gesamten Wertschöpfungskette bis 2040 klimaneutral sein. Das umfasst auch den Betrieb der Baumaschinen.
Viele Hersteller und Händler sind skeptisch, wollen das aber lieber nicht öffentlich formulieren. Ein Händler von Baumaschinen namhafter Hersteller, der namentlich nicht genannt werden will, erklärt „Wasserstoff ist ein Technologiethema für die Zukunft. Es wird vermutlich noch sehr lange dauern, bis er in der Breite Einzug hält und in großem Stil kommerziell nutzbar wird. Gründe hierfür seien beispielsweise die aktuell fehlende Skalierbarkeit, die fehlende Versorgungsinfrastruktur und der hohe Strompreis.
Und bei Sennebogen, einem namhaften Hersteller von Elektrokranen in Straubing, erfährt man auf ausdrückliche Nachfrage: „Wasserstoff-Konzeptmotoren, die auf Messen vorgestellt werden, sind einzelne Konzeptlösungen, die unter Laborbedingungen funktionieren, aber alles andere als marktreif sind. Sie fungieren daher momentan eher als Marketingtools, die die Innovationskraft einzelner Hersteller und der Branche zum Ausdruck bringen sollen.“ Das Erreichen der Marktreife werde noch viel Zeit in Anspruch nehmen, denn auf der Lernkurve stünde die Branche noch ganz am Anfang.
Teure Antriebe als Risiko für Anwender
Auf der Anwenderseite will Bauschuttrecycler Feess in Kirchheim/Teck, der 2016 den Deutschen Umweltpreis erhielt, mit seinem Fuhr- und Maschinenpark einen Trend setzen. Das Unternehmen besitzt rund 100 Baumaschinen wie Bagger und Radlader sowie mehr als 50 Lkw. Seniorchef Walter Feess hat sich deshalb auch mit Wasserstoff befasst. Er hält die Zeit dafür für noch nicht reif. Er will zunächst in stationäre Elektrokrane auf seinen Wertstoffhöfen investieren, die sich idealerweise aus eigenproduziertem PV-Strom speisen sollen.
Seine Prognose: „Auf Dauer wird es wohl auf ein breites Spektrum an Antriebslösungen je nach konkretem Anwendungsfall hinauslaufen, also Elektro, Akku, Wasserstoff und Diesel parallel.“ Ohnehin sei aktuell das Investitionsklima in der Baubranche ungünstig und Mehrkosten für deutlich teurere Antriebe jenseits des Verbrenners in Angebote einzupreisen, gefährde die Wettbewerbsfähigkeit.