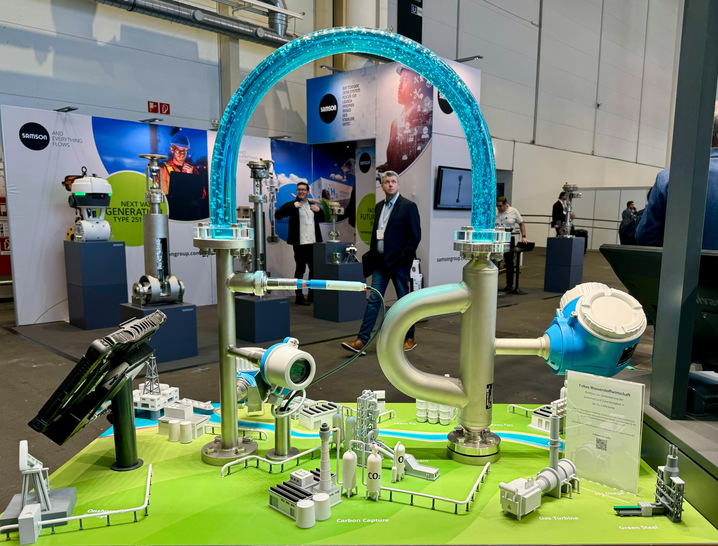Die Vertreter Schottlands schenken ihren Gästen noch älteren Single Malt ein; Japaner servieren Sushi und die Norddeutschen Currywurst. Von der landesspezifischen Kulinarik mal abgesehen, eint die mehr als tausend Aussteller vermutlich die Hoffnung, dass es nun, angesichts des verzögerten Wasserstoffhochlaufs, eigentlich nur noch besser werden kann.
Nachdem sich in den vergangenen Monaten Meldungen über verschobene oder abgesagte Projekte gehäuft hatten, ließen sich auf der Hydrogen Technologie World Expo weder Pioniere noch alteingesessene Unternehmen, deren Geschäftsmodell nicht allein auf Wasserstoff basiert, die Stimmung vermiesen. Schließlich gibt es Hunderte von Wasserstoffprojekten in Europa und so setzen sie auf ihre eigenen Erfolge; große und kleine Fortschritte, die sich sehen lassen können.
Wasserstoff-Drohne für Rettungseinsätze
Davon konnten sich Besucher in der von drei auf sieben Hallen ausgeweiteten Messe selbst überzeugen. Zum Beispiel die H2PM-Drohne des Zentrums für Angewandte Luftfahrtforschung (ZAL) in Hamburg. Im vergangenen Jahr noch ein Projekt ist der 25 Kilogramm schwere, mit Partnern entwickelte Oktokopter inzwischen auf dem Markt. Die mit Druckwasserstoff betriebene Drohne eigne sich insbesondere „für Rettungseinsätze, zur Überwachung von kritischer Infrastruktur sowie zur Detektion von Bränden oder Gasaustritten“, erklärt Sebastian Altmann, Senior Expert des Brennstoffzellenlabors im ZAL.
H2-Oktokopter ersetzt Helikopter
Bei einer Traglast von bis zu fünf Kilogramm kann sie zwei bis drei Stunden in der Luft bleiben und bis zu 150 Kilometer zurücklegen. Im Vergleich dazu bringt es eine batteriegetriebene Drohne nur auf eine gute halbe Stunde Flugzeit.
Die Wasserstoff-Drohne ist damit aber auch in der Lage, einen Hubschrauberflug zu ersetzen – zu einem Bruchteil des Preises. Letzterer kostet je nach Anbieter zwischen 1000 und 3000 Euro pro Stunde; die H2-Drohne hingegen 50 bis 100 Euro. Sie ist eigentlich für den Einsatz in der Industrie bzw. im zivilen Bereich gedacht. „Aber angesichts der geopolitischen Lage steigt auch das militärische Interesse an leistungsfähigen Drohnen für Überwachungszwecke spürbar an“, sagt Altmann auf Nachfrage von HZwei. Das ZAL schließt jedoch aus, waffentragende Drohnen zu entwickeln. Im Gegenteil, nun geht es in der Forschung verstärkt um die Abwehr von Militär- und Spionage Drohnen.
H2-Gepäckschlepper erstmals im Praxistest
In jedem Fall harmlos kommt dagegen ein rotes Gefährt in der Halle B5 daher, das auf dem Hamburger Flughafen seit Juli 2025 im Test-Einsatz ist: Ein Gepäckschlepper, den Hydro Technology Motors (HTM) aus Bingen am Rhein von Erdgas- auf Wasserstoffantrieb umgerüstet hat.
Zwei mit Karbonfasern verstärkte Drucktanks (350 bar) auf der Ladefläche werden bei Bedarf über eine mobile Tankeinheit von Ryze Power direkt am Flughafen befüllt. Die Umrüstung bestehender Fahrzeuge ist laut HTM eine „kostengünstige und umweltfreundliche Alternative zu neuen batterie- oder brennstoffzellenbetriebenen Fahrzeugen.“ Zehn Kilogramm Wasserstoff reichen einen Dreischichtbetrieb.
Der erste Praxistest eines auf Wasserstoff-Verbrennung umgebauten Gepäckschleppers hat bewußt auch während der besonders verkehrsreichen Sommermonate stattgefunden. Wissenschaftlich begleitet wird das EU-geförderte Projekt BSR HyAirport im Rahmen des Energiewende-Verbundprojekts Norddeutsches Reallabor.

© Monika Rößiger

© Monika Rößiger
Wichtig für europäische Flughäfen
Die Ergebnisse hinsichtlich technischer und wirtschaftlicher Machbarkeit sind nicht nur für die weiteren rund 60 mit Erdgas betriebenen Gepäckschlepper in Hamburg wichtig, sondern für Flughäfen in ganz Europa. Denn die erhobenen Daten werden mit den Betreibern geteilt. Hamburg Airport ist ohnehin überzeugt, „dass Wasserstoff eine bedeutende Rolle in der Zukunft der Luftfahrt am Boden und natürlich auch in der Luft spielen wird.“

© Monika Rößiger
Elektrolyse ohne Platin
Einen „echten Leistungsschub“ für Elektrolyseure verspricht José Manuel Sanchis Bernat am Stand von Matteco, einer Ausgründung der Universität von Valencia. „Unsere Elektroden und Katalysatoren der nächsten Generation steigern die Wasserstoff-Ausbeute von AWE- und AEM-Elektrolyseuren“, sagt Iker Marcaide, Mitgründer und CEO von Matteco.
Das liege an der vergrößerten katalytischen Oberfläche. Fortschrittliche Materialien – ohne Platin – erhöhen die Effizienz der H2-Erzeugung und tragen somit ihren Teil zur Skalierung der Wasserstoff-Technologien insgesamt bei. „Mit unseren Nickel-Eisen-Katalysatoren sinken die LCOH um bis zu 20 Prozent. Und das bei minimaler Degradation.“
Neben nachhaltigeren Katalysatoren gab es weitere innovative Produkte, Prozesse und Materialien. So untersucht etwa die Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung (BAM) den Einsatz glasfaserverstärkter Kunststoffleitungen als Alternative zu herkömmlichen Stahlleitungen für Wasserstoff. Ziel ist es, neue Leitungssysteme zu entwickeln, die auch unter hohen Drücken leistungsfähig bleiben und dabei Kosten im Vergleich zu bisherigen Lösungen reduzieren.
Asien an der Waterkant
Norddeutschland präsentierte sich in Halle 6 mit seiner geballten Wasserstoff-Kompetenz, sowohl was Forschung als auch Unternehmen angeht. Delegationen aus Japan und Südkorea zeigten an den Projekten dieser Region besonderes Interesse, darunter Mitarbeiter des japanischen Umweltministeriums, der Energieagentur Fukushima sowie Außenhandelsvertreter.
Auch eine Gruppe von Journalisten aus sieben EU-Ländern, die auf Recherche in der Metrolpolregion war, besuchte die Messe. Die Hansestadt will ein führender Standort für Wasserstoff werden. Das betrifft sowohl die Erzeugung und den Import von grünem Wasserstoff als auch dessen Nutzung in Industrie, Wirtschaft und Verkehr.

© Monika Rößiger
Klotzen statt Kleckern
Zentrale Projekte dafür sind der Bau eines 100 Megawatt-Elektrolyseurs („Hamburg Green Hydrogen Hub“) am Standort des ehemaligen Kohlekraftwerks Moorburg sowie ein 60 Kilometer langes Wasserstoff-Leitungsnetz für große Industriebetriebe. Hinzu kommt der Bau des ersten großen Importterminals in Deutschland für Wasserstoff und dessen Derivate im Hafen.
So nahm sich Hamburgs Erster Bürgermeister Peter Tschentscher während seines Messe-Rundgangs auch die Zeit, um bei den Unternehmern der Branche zum Beispiel nachzufragen, wo es hakt und was die Politik dagegen tun könne.
Sekt für die Wasserstoff-Fans
„Insgesamt war die Stimmung auf der Messe durchaus positiv“, resümiert Jan Rispens, Leiter des Erneuerbaren Energieclusters Hamburg, das den Gemeinschaftsstand mit 15 Unternehmen organisiert und betreut hat. „Einige bedeutende Projekte gehen voran in Europa, die Technologieentwicklung hat ordentlich Schwung, und Investoren sind nach wie vor interessiert an der Projektentwicklung.“ Am Ende des zweiten Tages knallten dann auch bei HZwei die Sektkorken: Gemeinsam mit dem Deutschen Wasserstoff Verband hat der Verlag zu einem Empfang geladen.

© Monika Rößiger