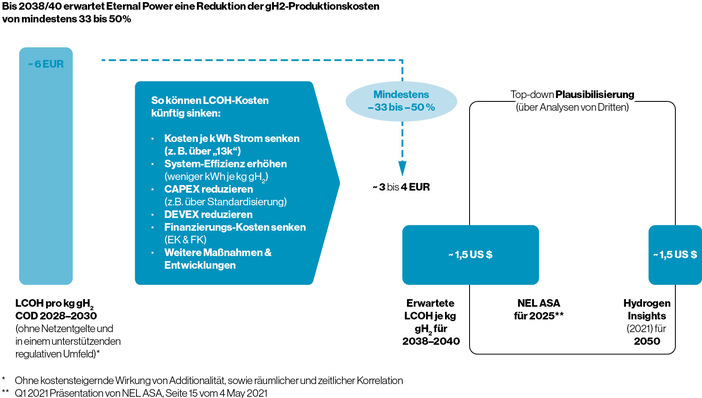© EnBW
Dieser Artikel ist einer derjenigen, bei denen man beim Redaktionsschluss hofft, dass sie beim Erscheinen schon ein bisschen überholt sind. Denn die Zeit drängt. Deutschland braucht schnell verfügbare Kraftwerksleistung. Dass Anfang 2026 wirklich Ausschreibungen dafür starten, ist jetzt, Anfang November, schwer vorstellbar.
Die Dringlichkeit der Lage ist aber auch schon alles, auf das sich nahezu alle Beteiligten einigen können. Alles andere ist unklar. Wie viel Kraftwerksleistung braucht man? Wie sorgt man für einen wirtschaftlichen Betrieb, sodass sich auch Investoren finden? Und natürlich: Wann und wie sollen die Kraftwerke klimaneutral mit Wasserstoff betrieben werden? Hier sind die wichtigsten Handlungsstränge der Debatte um die Kraftwerksstrategie.
Warum überhaupt Kraftwerksstrategie?
Am Ende der Ampel‑Regierung, im November 2024, gab es einen Referentenentwurf des Bundeswirtschaftsministeriums (mit vollem Namen: Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz) für das sogenannte Kraftwerkssicherungsgesetz, kurz KWSG. Die Idee: Gaskraftwerke, die sich perspektivisch auf Wasserstoff umstellen lassen, sollen als Back‑up für die Stromerzeugung aus Wind und Sonne fungieren. In einem freien Strommarkt sind solche Gaskraftwerke allerdings schon seit Jahrzehnten ein ungeliebtes Geschäftsmodell. Denn immer dann, wenn Wind‑ und Solarstrom reichlich produziert werden, sind sie auch billig und drängen die Gaskraftwerke aus dem Markt. Die Gaskraftwerke müssten sich also über immer weniger Betriebsstunden finanzieren, denn gehandelt wird auf dem Strommarkt nur erzeugte Energie, nicht bereitgehaltene Leistung (die in diesem Kontext oft als Kapazität bezeichnet wird) – und Leistung lohnt sich hier wirklich nicht. Das bringt existierende Gaskraftwerke an den Rand der Wirtschaftlichkeit, von Neubauten ganz zu schweigen. Das Problem ist seit weit über zehn Jahren bekannt, viele Fachleute rufen nach einem sogenannten Kapazitätsmarkt. Das heißt: der Staat schreibt gesicherte Kapazitäten aus und bietet den Kraftwerksbetreibern für deren Bereithalten eine Art Grundeinkommen.
Der Referentenentwurf aus dem Ministerium von Robert Habeck war die erste Gesetzesinitiative, die sich dieses Problems annahm. Dabei sollten verschiedene Technologien konkurrieren können. Als Voraussetzung galt aber eine perspektivische Klimaneutralität – bei Gaskraftwerken musste man also von vornherein daran denken, dass sie sich auf Wasserstoff umrüsten lassen. Insgesamt 12,5 Gigawatt Kraftwerkskapazität sollten so sichergestellt werden. Beihilferechtliche Fragen mit der EU waren nach langen Vorgesprächen weitgehend ausgeräumt. Der Bundesverband der Energie‑ und Wasserstoffwirtschaft (BDEW) forderte daher, diesen Gesetzesentwurf als Grundlage zu nehmen, auch wenn aus Sicht der Kraftwerksbetreiber noch einige Änderungen nötig wären.
Was ändert sich mit Katherina Reiche?
Das Bundeswirtschaftsministerium (nun: Bundesministerium für Wirtschaft und Energie) unter Katherina Reiche geht davon aus, dass Deutschland nicht 12,5 Gigawatt flexible Kraftwerksleistung benötigt, sondern 20 Gigawatt – und zwar explizit in Form von Gaskraftwerken und trotz eines geringeren prognostizierten Strombedarfs als bisher. Dabei setzt sie auf ein „pragmatisches“ Vorgehen, wie sie betont. Das heißt: Erst einmal sollen die Kraftwerke gebaut werden; ob und wie man sie auf Wasserstoff umstellen kann, soll später entschieden werden. Doch damit setzt sie die Beihilfe‑Diskussion mit der EU zurück auf Null, denn die EU fordert Technologie- und Klimaneutralität.
Reiche hofft nun, eigenen Aussagen zufolge, auf ein „Schnellboot‑Programm“ mit direkt bezuschussten fünf bis zehn Gigawatt Kraftwerkskapazität. Von der EU habe man positive Signale für „deutlich mehr als die Hälfte“ der angedachten 20 Gigawatt erhalten, wird sie in Wirtschaftsmedien zitiert. Schriftlich lag bei Redaktionsschluss Anfang November über diese Pläne noch nichts vor – kein Referentenentwurf eines neuen Gesetzes und keine Notifizierung bei der EU.
Erste H2‑ready‑Kraftwerke von EnBW
Verschiedene Kraftwerksbetreiber planen, bauen und betreiben bereits Gaskraftwerke, die zumindest anteilig mit 20 bis 30 Prozent Wasserstoff befeuert werden könnten, wenn es ihn denn gäbe.
Im Oktober 2025 nahm EnBW in Stuttgart‑Münster eines der ersten wasserstofffähigen Gasturbinenkraftwerke in Deutschland in den kommerziellen Betrieb. An den Standorten im Süden Deutschlands wird die gesicherte Erzeugungsleistung besonders dringend benötigt, denn dort gibt es zugleich einen hohen Energiebedarf durch die Industrie und wenig Windstromerzeugung. Dass EnBW die Investition riskierte, obwohl das Kraftwerkssicherungsgesetz noch nicht fertig ist, liegt auch an einer anderen Förderung - dem Kraft‑Wärme‑Kopplungs‑Gesetz. In dessen Rahmen erhielt der Konzern einen Zuschuss. Allein durch diesen „Fuel Switch“ soll der CO2‑Ausstoß um 60 Prozent sinken.
Nicht nur für Stuttgart‑Münster, sondern auch für das Ersetzen der Kohlekraftwerke Altbach/Deizisau und Heilbronn. Alle drei zusammen sollen eine Erzeugungsleistung von rund 1,5 Gigawatt haben. In Stuttgart‑Münster handelt es sich genau genommen nicht um ein eigenes Gaskraftwerk, sondern um die Ergänzung für ein Müllheizkraftwerk, die bisher mit drei Kohlekesseln erfolgte. Die neue Anlage soll 124 MW elektrische und 370 MW thermische Leistung liefern. Den Umstieg auf Wasserstoff visiert EnBW für die zweite Hälfte der 2030er‑Jahre an. Dafür wären Änderungen an der Brennstoffversorgung der Gasturbine sowie natürlich eine komplette Wasserstofflogistik nötig.
Die beiden anderen wasserstofffähigen Kraftwerke der EnBW sind noch nicht so weit. In Altbach‑Deizisau baut man seit November 2023, die Fertigstellung ist derzeit für das 1. Quartal 2027 terminiert. In Heilbronn begann der Bau im Februar 2024, die Inbetriebnahme ist für die zweite Jahreshälfte 2027 vorgesehen. Alle drei Kraftwerke koppeln auch Wärme aus und werden daher über das Kraft‑Wärme‑Kopplungs‑Gesetz gefördert.
Hamburg: GuD-Kraftwerk soll 2026 in Betrieb gehen
Kräftig unter Zeitdruck sind auch die Hamburger Energiewerke. Sie sind gerade dabei, eine neue Gas‑ und Dampfturbinenanlage im Hafengebiet zu bauen. Bis zu 30 Prozent Wasserstoff soll diese verbrennen können. Wenn es einmal mehr werden soll, sollen die Anpassungen im Rahmen der normalen „Produktpflege“ bei den routinemäßigen Revisionen machbar sein.
Dass Hamburg sich für das Wasserstoffkraftwerk entschied, geht auch auf politischen Druck zurück. Mit starken Kontroversen sowie zwei Volksinitiativen, von denen eine bis zum Volksentscheid kam, erstritten die Hamburger den Umbau des Fernwärmenetzes.
Das neue wasserstofffähige Kraftwerk soll das marode Heizkraftwerk Wedel ersetzen, das nur noch mit Ausnahmegenehmigungen läuft. Da es aber für die Fernwärmeversorgung im Westen der Stadt essenziell ist, muss es durchhalten, bis der Ersatz fertig ist – einschließlich einer neuen Leitung unter der Elbe hindurch, um die Wärme aus dem Hafen in die Stadt zu bringen. Die Bauarbeiten, auch an den Leitungen, sind in vollem Gange.
Das Kraftwerk soll eine Förderung nach dem Kraft‑Wärme‑Kopplungs‑Gesetz (KWKG) erhalten, ebenso wie die Kraftwerke der EnBW. Ob und welche Bedeutung ein Kapazitätsmarkt haben wird, ist noch unklar, denn das Kraftwerk soll wärmegeführt betrieben werden und möglichst kurze Laufzeiten haben, um erneuerbaren Wärmequellen den Vorrang zu lassen – so zumindest lautet der bisherige Plan. Das schlägt sich auch in den Leistungsdaten nieder: Die elektrische Leistung liegt lediglich bei 180 MW, während die Anlage bis zu 290 MW Wärme liefern kann. Darin ist allerdings auch eine Power‑to‑Heat‑Anlage eingerechnet, die bei reichlichem Stromangebot im Markt Wärme aus Strom gewinnt. Weil Strom‑ und Wärmeerzeugung nicht immer gleichzeitig gefragt sind, ist auch ein Wärmespeicher vorgesehen, der 50 000 Kubikmeter Wasser fassen soll.
Laut den Hamburger Energiewerken ist nun das GuD‑Kraftwerk zu 85 Prozent fertiggestellt, auch wenn sich die Installation mancher Rohrleitungen als aufwändiger erweist, als gedacht. Damit es Ende 2026 nun wirklich klappt, sind 100 zusätzliche Monteure im Einsatz, lässt der städtische Energieversorger wissen.
RWE will Standort Voerde zum Wasserstoff-Hub machen
RWE würde am Standort Werne‑Stockum gern ein wasserstofffähiges Gaskraftwerk errichten, doch das Projekt hängt in der Warteschleife. Vorgesehen sind 800 Megawatt elektrische Leistung; bis zu 50 Prozent davon sollen aus Wasserstoff erzeugt werden können. Die Genehmigungsplanung sei abgeschlossen, heißt es in der Pressemitteilung. Auch in Weisweiler erklärte RWE 2023, mit der Genehmigungsplanung begonnen zu haben. Ende Oktober dieses Jahres kündigte RWE außerdem an, auch den Kraftwerksstandort in Voerde wieder aktivieren zu wollen. Dort lief bis 2017 ein Steinkohlekraftwerk der STEAG, das aber nicht mehr rentabel war. RWE übernahm den Standort 2021, um dort Wasserstoffprojekte zu entwickeln. In einer Ankündigung aus dem Jahr 2023 war von einem 400-MW-Elektrolyseur die Rede. Nun ist ein neues Gaskraftwerk im Gespräch, mit 850 MW Leistung und ebenfalls bis zu 50 % wasserstofffähig. Die Planung hatte RWE bereits 2024 bei einem amerikanisch-spanischen Konsortium aus GE Vernova und Tecnicas Reunidas beauftragt, die Genehmigungsplanung „auf Basis bewährter Technologien“ liege vor. Nach aktueller Planung könnte die Anlage in Voerde 2030 die Stromproduktion aufnehmen. RWE gibt sich entschlossen, an den Ausschreibungen der Bundesregierung teilzunehmen – und fordert diese auf, die Bedingungen bekannt zu geben.
LEAG drängt auf Ansage für Schwarze Pumpe & Co
Auch die Lausitz Energie Kraftwerke AG (LEAG) will gern ihren Standort Schwarze Pumpe für die Energiewende fit machen. Bis zu 850 Megawatt könnte ein wasserstofffähiges Gaskraftwerk hier haben, aufbauend auf der vorhandenen Infrastruktur des großen Kohlekraftwerks. Bis 2030 sollen 3 000 Megawatt Kohlekraftwerke vom Netz gehen. Das geht nur, wenn die gesicherte Leistung ersetzt wird.
Neubauprojekte für H₂‑ready‑ Kraftwerke mit zusammen rund 2 000 MW sind für die Standorte Schwarze Pumpe, Lippendorf und Leipheim in Planung. Bei manchen liegen bereits Teilgenehmigungen vor, erklärt Pressesprecher Thoralf Schirmer auf Anfrage von HZwei. Genauere technische Angaben könne man aber noch nicht machen.
„Jetzt ist die Politik gefragt, den Investitionsstau bei Zukunftskraftwerken mit einer klaren Regulatorik und fairen Ausschreibungsbedingungen aufzulösen“, sagte Adi Roesch, der Vorstandsvorsitzende der LEAG, bei einem Besuch von Reiche am Kraftwerksstandort Schwarze Pumpe. Reiche versicherte, man werde „einen signifikanten Anteil der geplanten 20 Gigawatt Gaskraftwerkskapazität noch in diesem Jahr in den Markt stellen und in eine Versteigerung geben“. Diese Ankündigung ist auch Anfang November, bei Druckschluss dieser Ausgabe, noch der Status quo.
Mit Wasserstoff können die Kraftwerke natürlich nur laufen, wenn es ihn gibt. Wirtschaftsministerin Reiche erklärte im Zusammenhang mit dem Energiewende-Monitoring bereits, Kernnetz und Importkorridore sollten stufenweise und abhängig von der Nachfrage aufgebaut werden – die sie wiederum nicht sonderlich forcieren will. Die Technik und die Kraftwerksbetreiber jedenfalls wären bereit.

© LEAG