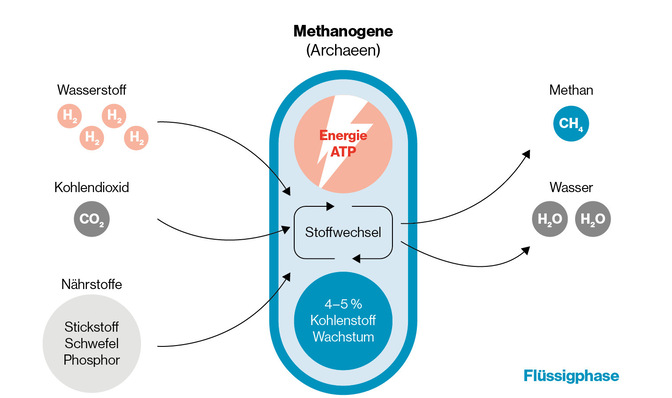Schon die Atmosphäre auf der Rennbahn ist besonders: „Natürlich möchte jeder das Maximum aus seinem eigenen Auto herausholen, aber wenn eine Schraube fehlt, kann man ohne Probleme bei einem anderen Team um Hilfe bitten“, sagt Jasmijn Oude Nijhuis, Sprecherin des Teams HyDriven Twente aus den Niederlanden. Diese Kombination aus gesunder Rivalität und Zusammenarbeit macht die Formula Student zu einer inspirierenden Lern- und Testumgebung für Studenten aus aller Welt.
Die Technik der Holländer unterscheidet sich von den anderen teilnehmenden Teams. „Es war eine besondere Erfahrung, als erstes und einziges Wasserstoff-Brennstoffzellenauto teilzunehmen, galt aber ebenso für den Wettbewerb selbst, da ein neues Rennauto und ein neuer Kraftstoff ein völlig neues Regelwerk benötigen“, beschreibt sie die zu meisternde Challenge.
Letztendlich liegt es in der Verantwortung jedes Teams, dafür zu sorgen, dass das Auto erst einmal zugelassen wird. Das macht den Wettbewerb so intensiv und lehrreich zugleich. Jeder Fehler wird sofort sichtbar, jede Entscheidung zählt. Wasserstoff sei eine ernstzunehmende Option für die Energiewende, glaubt Nijhuis: „Es ist unser Ziel, diese Technologie sichtbar zu machen und andere zu inspirieren, neue und nachhaltige Lösungen zu erforschen.“

© FSA
Wasserstofftankstelle betankt mit bis zu 350 bar
Das Rennen fand Ende Juli 2025 am Red Bull Ring statt. 58 Teams mit der neuen Rekordanzahl von 1.800 Teilnehmenden aus 16 Nationen stellen bereits einen Erfolg dar. Erstmals starteten zudem zwei rein mit Wasserstoff betriebene Boliden. Ein weiteres Highlight: Die neu installierte Wasserstofftankstelle mit bis zu 350 bar hat der Veranstalter in nur 20 Stunden aufgebaut und in Betrieb genommen – inklusive einer Probebetankung.
„Vor zwei Jahren haben wir mit der H2 Concept Challenge angefangen, um die Formula Student Teams auf das neue Projekt H2 vorzubereiten und ein neues Reglement zu entwickeln“, erklärt Steffen Schmitt, Head of Hydrogen Formula Student Austria (FSA). Am Start war das Team HyDriven Twente mit einer Brennstoffzelle. Als zweites H2-Team hat Ka-RaceIng aus Karlsruhe einen schon bestehenden Rennwagen von E85 auf Wasserstoff umgerüstet.
Die FSA versteht sich als Konstruktionswettbewerb, die zukünftige Ingenieure ausbildet – Verbrenner sind also weiter zugelassen. „Wir wollen so technologieoffen wie möglich sein“, betont Schmitt. Die Verbrenner seien allerdings bilanziell CO2-neutral, da sie mit synthetischen Kraftstoffen oder grünen Wasserstoff betrieben werden. „In den letzten drei Jahren hatten wir eine konstante Teilnehmerzahl bei der Hydrogen Concept Challenge, wo die Teams ihr zukünftiges auf Wasserstoff basiertes Antriebskonzept den Fachexperten vorstellen können“, berichtet Schmitt.
Einige der Teilnehmer haben auch konkrete Absichten, ein Wasserstoffauto zu bauen. Aktuell sind mindestens drei zusätzliche Teams dabei, die einen Wasserstofftank für ihren zukünftigen Wasserstoff-Verbrenner beschafft haben oder zumindest ein Budget haben. Sie sind aktuell im Auswahlprozess. „Wir erwarten drei bis fünf Verbrenner-Teams und ein bis zwei Fahrzeuge mit Brennstoffzelle 2026.“
H2-Bolide wiegt 55 Kilogramm zusätzlich
Der Rennwagen von Ka-RaceIng hat nicht nur das eigene Team überzeugt. Ziel der Karlsruher war es, einen mit Wasserstoff betriebenen Verbrenner zu präsentieren. Letztendlich konnte der Bolide an allen dynamischen Disziplinen des Wettbewerbs teilnehmen. Besonders überraschend war das relativ geringe Gesamtgewicht des Fahrzeugs. Es brachte nur rund 220 Kilogramm auf die Waage. „Man muss bedenken, dass durch den Wasserstofftank sowie einer zusätzlichen Rahmenkonstruktion, die den Boliden im Crashfall schützen soll, rund 55 Kilogramm zusätzlich im Vergleich zu einem herkömmlichen Verbrenner aus dem Jahr 2019 dazugekommen“, erklärt Schmitt. Die Karlsruher zeigten, dass die Konstruktion eines Wasserstoffahrzeugs mit einem annehmbaren Gesamtgewicht möglich ist.
Eine Umrüstung eines bestehenden Rennwagens mit herkömmlichen Verbrennungsmotor auf den H2-Betrieb benötigt Partner, die Material oder finanzielle Mittel zur Verfügung stellen, wobei der Wasserstofftank und Sicherheitsventile wie On-Tank-Valves (OTV) die teuersten Komponenten sind. „Eine komplette Neufertigung bewegt sich im sechsstelligen Bereich, sodass wir in den Hydrogen Rules die Verwendung von bestehenden Chassis erlauben“, sagt Schmitt. Die Einstiegshürde für die Teams soll so leichter zu nehmen sein – und die Teilnehmer können sich auf die nötigen Anpassungen für den Betrieb mit Wasserstoff und die Implementierung des Antriebsstrang sowie des Tanks konzentrieren.
Die Platzierung des Tanks mit 350 bar war für beide Teams jedoch eine Herausforderung. HyDriven Twente hat sich für strukturelle Seitenkästen entschieden, sodass auf einer Seite der Wasserstofftank und auf der anderen Seite die Hochvoltbatterie Platz gefunden hat. Ka-RaceIng hat den bestehenden Heckflügel demontiert und an dieser Stelle hinten quer eine Rahmenkonstruktion angebracht, in der der Wasserstofftank beinhaltet ist. Insgesamt war für die teilnehmenden Teams die Beschaffung eines nach Automobilnorm zertifizieren Wasserstofftanks mit zwei Kilogramm Volumen eine weitere Herausforderung.
Neues Regelwerk für H2-Boliden
Für den Veranstalter war die Erstellung eines neuen Regelwerks für den Wettbewerb mit passenden Randbedingungen sowie die Bereitstellung des Wasserstoffs und der Betankungsinfrastruktur herausfordernd und Neuland zugleich. „Zusätzlich zu den 140 Seiten umfassenden Seiten der Formula Student Rules haben wir in Zusammenarbeit mit fünf anderen Events letztes Jahr die Hydrogen Rules mit 40 Seiten erarbeitet und veröffentlicht“, erläutert Schmitt. Die enthält alle wasserstoffspezifischen Themen von der Norm und Größe des Wasserstofftanks, über alle zusätzlichen Sensoren, die die Teams in den sogenannten Shut-down-Circuit integrieren müssen, bis hin zu Vorschriften für strukturellen Seitenkästen.
Die Betankungsinfrastruktur wurde mit der Firma Maximator Advanced Technology realisiert und der Versorger Wiener Energie hat einen Trailer mit grünem Wasserstoff bereitgestellt. Die FSA ist die erste Rennveranstaltung am Red Bull Ring, bei der H2-Fahrzeuge konkurrieren. Zukünftige Rennen könnten nun auf erprobte Sicherheitskonzepte zurückgreifen.
Auch die Teams müssen viel lernen. Der Veranstalter bietet in Zusammenarbeit mit LIFTE H2 eine Hydrogen Safety Officer (HSO) Schulung an. Hierbei lernen die Teilnehmer einen sicheren Umgang mit Wasserstoff sowie Grundlagen über Wasserstofftanks, Ventile und andere Sicherheitseinrichtungen. Bei den Verbrennern gibt es im Vergleich zu den BZ-Fahrzeugen deutliche weniger technische Herausforderungen.

© FSA
Details zum Rennauto müssen vorher eingereicht werden
In der Vorbereitung des Rennens müssen die Teams das Dokument Hydrogen Safety File (H2SF) einreichen. Darin erklären sie das Tanksystem sowie des Antriebsstrang und liefern alle nötigen Datenblätter und Prüfzertifikate. Dadurch kann der Veranstalter den Entwicklungsprozess beurteilen und die Entwicklung konstruktiv beeinflussen. Vor Ort kann ein Wasserstoffdetektionsgerät bei der Betankung Fehler im Wasserstoffsystem erkennen.
Während die Teams in den Boxen an den Autos schrauben, sind die Wasserstofftanks im Freien in einem abgezäunten Bereich sicher verwahrt. „Wir haben insgesamt großen Wert darauf gelegt, dass die Teams das zentrale H2 Element mit Tank, OTV und Druckreduzierung von Industriepartnern beziehen, welche alle Prüfungen und Vorschiften einhalten“, betont er. Viele andere Teile an dem Rennauto seien selbst entwickelt, aber bei so einer kritischen Baugruppe möchten der Veranstalter das vermeiden. Das Sicherheitskonzept hat bisher sehr gut funktioniert. Künftig wird es nur ein paar Anpassungen beim alltägliches Arbeiten mit Wasserstoff geben. Die neuen H2-Regeln sollen Mitte Oktober veröffentlicht werden.
Für den Nachwuchs: Wasserstoff-Grand-Prix in Chemnitz
Eine Nummer kleiner als bei der Formula Student waren die Rennwagen in Chemnitz. Beim Weltfinale des Wasserstoff-Grand-Prix traten Ende August mehr als 60 Schüler- und Studierendenteams aus 23 Ländern mit selbst entwickelten H2-Rennfahrzeugen im Modellautoformat gegeneinander an.
Das Fraunhofer-Institut für Werkzeugmaschinen und Umformtechnik (Fraunhofer IWU) hat zusammen mit Horizon Educational und der H2 GP Stiftung das Weltfinale ausgerichtet. Die Teams starteten in vier Klassen: Sprint, Stock, Hybrid und Prototype. Ziel war es, mit funkgesteuerten und mit H2 betrieben Modellfahrzeugen möglichst viele Runden innerhalb einer festgelegten Zeit zu absolvieren. Bewertet wurden neben der Fahrleistung auch Teamgeist, Design, Innovationskraft, Präsentation und Boxenstrategie.