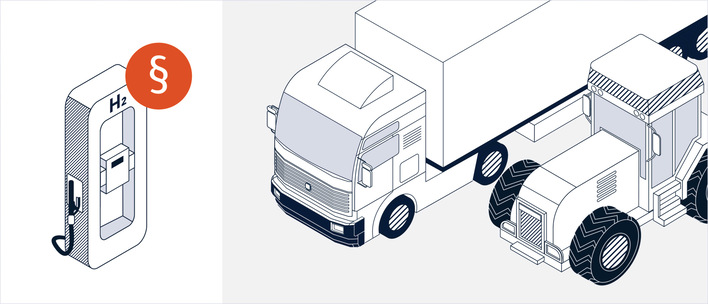Der Deutsche Wasserstoff-Verband (DWV) hat am 26. November 2025 seinen Parlamentarischen Abend in der Landesvertretung der Freien und Hansestadt Hamburg in Berlin veranstaltet. Über 140 Gäste aus Politik, Wirtschaft und Wissenschaft nahmen teil. Im Mittelpunkt der Veranstaltung standen die politischen und wirtschaftlichen Rahmenbedingungen für den Markthochlauf der Wasserstoffwirtschaft.
DWV-Präsidentin Silke Frank betonte in ihrer Begrüßung die Rolle des Verbands als „Brückenbauer und Taktgeber eines integrierten Energiesystems – mit der Kraft von 1,5 Millionen Arbeitsplätzen.“ Sie forderte eine enge Kooperation entlang der gesamten Wertschöpfungskette und ein Marktdesign, „das Investitionen absichert, Anwendungsmärkte öffnet und private Mittel mobilisiert.“
Wasserstoff als industriepolitisches Kernprojekt
Wasserstoff müsse als industriepolitisches Kernprojekt verstanden werden, nicht nur als Teil der Energiepolitik. Zudem sei es nun an der Zeit, marktfähige Geschäftsmodelle zu etablieren: „In den letzten Jahren haben wir zurecht erheblich in Pilot- und Demonstrationsprojekte investiert. Jetzt kommt es darauf an, aus dieser Phase in eine Wasserstoffmarktwirtschaft zu kommen, die sich selbst trägt.“
Dr. Bernd Pitschak, Vorstandsvorsitzender des DWV, hob hervor, dass Wasserstoff „die verbindende Infrastruktur der Energiewende“ sei sowie die Brücke „zwischen Klimaschutz und Wertschöpfung.“ Entscheidend für den Übergang in die Marktreife seien verlässliche Nachfrage, klare Leitmärkte und beschleunigte Verfahren. „Wir brauchen eine strategische öffentliche Beschaffung, die CO₂-arme Produkte bevorzugt – etwa im Stahl-, Chemie- und Bauwesen.“
DWV: Genehmigungsdauer halbieren und bundesweit einheitliche Standards schaffen
Zugleich brauche es „langfristige Abnahmeverträge für die Wasserstoffproduzenten über zehn bis fünfzehn Jahre, um Investitionen abzusichern.“ Beides könne mit Werkzeugen wie „H2 National“ oder Klimaschutzverträgen gestützt werden. Hinsichtlich der Verfahren fordert der DWV: „Halbierung der Genehmigungsdauer – und einheitliche Standards bundesweit.“
Mit Blick auf China, wo Wasserstoff im Fünfjahresplan eine tragende Rolle spielen soll, um die Energieversorgung unabhänger von Importen zu machen, führte Pitschak aus: „Insgesamt sind rund 600 Projekte für erneuerbaren Wasserstoff in Planung, etwa 100 davon produzieren bereits gemeinsam rund 220.000 Tonnen pro Jahr und machen damit etwa die Hälfte der globalen Kapazität aus. Mit dem Ziel, bis 2030 eine Elektrolyseleistung von 100 Gigawatt zu erreichen, positioniert sich China klar als einer der entscheidenden Treiber der globalen Energiewende.“
Hochlauf zu langsam, aber nicht aus technischen Gründen
In der anschließenden Paneldiskussion, moderiert von DWV-Vorständin Friederike Lassen, diskutierten Vertreter aus Bundestag, Industrie und Mobilität über Maßnahmen für den Markthochlauf, etwa Differenzverträge für Wasserstoff (CfD) und eine Anreizung der Nachfrage durch grüne Leitmärkte, z. B. Quoten für CO2-armen Stahl. Auf dem Podium: Elisabeth Winkelmeier-Becker (CDU, MdB), Michael Kellner (Bündnis 90/Die Grünen, MdB), Dr. Alexandra von Bernstorff (Luxcara), Dr. Tobias Bischof-Niemz (Enertrag), Dr.-Ing. Alexander Redenius (Salzgitter Mannesmann Forschung) und Dr. Jürgen Guldner (BMW).
Die Diskussion machte deutlich, dass wirtschaftlich tragfähige Abnahmeverträge (Offtake-Strukturen) und wettbewerbsfähige Strompreise als zentrale Hebel für die Umsetzung von Wasserstoffprojekten gelten. Aber auch China kam nochmal vor beziehungsweise der „unfaire Wettbewerb“, wie Michael Kellner unterstrich. Angesichts der geopolitischen Lage, insbesondere Ukraine, monierte er: „Wir diskutieren zuviel über das Alte. Und das verstellt den Blick darauf, was uns in Zukunft droht.“ Nämlich, dass Europa „die Zeche zahlt“ für Deals, die möglicherweise gerade zwischen den USA und Russland ausgehandelt werden. Das Publikum applaudierte.
Technologieführerschaft im Wasserstoffbereich sichern
„Wir brauchen noch stärkeres Engagement und Rückenwind, um die Technologieführerschaft im Wasserstoffbereich auch in Zukunft zu erhalten“,
resümierte Friederike Lassen am Ende der Debatte. Der DWV werde den Dialog mit Politik und Wirtschaft fortsetzen, um die nächsten Schritte im Markthochlauf zu begleiten.
Nach eigenen Angaben zählt der DWV, der sich seit über 20 Jahren für die Transformation der Energieversorgung durch Wasserstofftechnologien engagiert, mehr als 150 institutionelle Mitglieder, darunter Unternehmen und Forschungseinrichtungen sowie über 350 Einzelpersonen. Zu den Zielen des Netzwerks gehört, politische und regulatorische Rahmenbedingungen zu schaffen, die den Markthochlauf von Wasserstofftechnologien ermöglichen. Der Verband vertritt die Interessen seiner Mitglieder auf nationaler und europäischer Ebene.