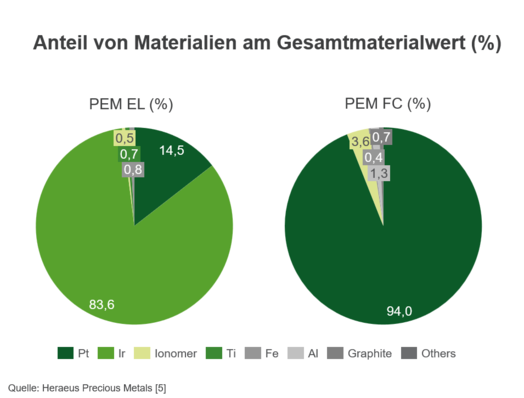Ein Jahr nach ihrer Gründung diskutierten die Vertreter der Initiative bei einem Strategiegespräch die aktuellen Entwicklungen in der Wasserstoffwirtschaft. Die Dresdner Akteure haben bereits AEL- und SOEC-Technologien so weit skaliert, dass sie in zahlreichen Projekten mit deutschen und europäischen Industriepartnern eingesetzt werden können.
Die Initiative fordert, dass der integrierte Klima- und Transformationsfonds (KTF), der mit 100 Milliarden Euro ausgestattet werden soll, den Aufbau industrieller Elektrolysekapazitäten in Deutschland priorisiert. Bis 2030 sollen mindestens zehn Gigawatt Elektrolyseleistung entstehen – ein Ziel, das politisch beschlossen, aber bislang nicht finanziell gesichert ist.
"Grüner Wasserstoff wird die deutsche Industrie langfristig prägen – er ist ein Schlüssel für eine klimaneutrale und starke Wirtschaft. Dresden steht dabei im Zentrum der europäischen Wasserstoff-Expertise mit Forschung, Netzwerken und innovativen Unternehmen, die den Wandel aktiv gestalten", betont Nils Aldag, CEO von Sunfire.
Professor Alexander Michaelis vom Fraunhofer IKTS ergänzt: "Wasserstoff kann zum Rückgrat einer resilienten und leistungsfähigen Industrie werden – wenn wir in Europa Wertschöpfungsketten aufbauen, statt auf kurzfristige Lösungen zu setzen. Dafür braucht es klare politische Signale und stabile Rahmenbedingungen für Forschung, Entwicklung und industrielle Anwendung."
Die drei Partner bringen unterschiedliche Kompetenzen in die Initiative ein: Linde Engineering treibt den Ausbau der Infrastruktur voran, Sunfire liefert Elektrolyseure im industriellen Maßstab und das Fraunhofer IKTS entwickelt Systeme und Prozesse für eine effizientere Wasserstoffherstellung und -nutzung.
"Ohne eine durchdachte Infrastruktur bleibt das Potenzial von Wasserstoff ungenutzt. Netz- und Speicherkapazitäten müssen mit der Produktion Schritt halten, damit die Technologie langfristig wirtschaftlich tragfähig ist", sagt Dr. Reinhart Vogel, Geschäftsführer von Linde Engineering Dresden.
Als entscheidenden Faktor für den Hochlauf der Wasserstoffwirtschaft nennt die Initiative, die Nachfrage seitens der Industrie zu unterstützen. Besonders in Sektoren wie Raffinerien oder der Chemieindustrie könnten gezielte Vorgaben für den Einsatz von grünem Wasserstoff kurzfristig Marktimpulse setzen – ohne neue Subventionen. Eine verbindliche Grüngasquote oder regulatorische Anreize für den Einsatz von Elektrolyseuren würden Investitionsentscheidungen beschleunigen.
Studien belegen, dass durch den Aufbau einer Wasserstoffwirtschaft in Deutschland bis 2030 rund 71.000 neue Arbeitsplätze entstehen könnten – davon etwa 10.000 allein in Mitteldeutschland. HyDresden fordert daher eine Industriepolitik, die konsequent auf europäische Wertschöpfung setzt, Planungssicherheit schafft und klare Investitionssignale sendet.
Neben politischen Rahmenbedingungen betont die Initiative die Bedeutung von Fachkräften. Ein zentraler Baustein von HyDresden sei es darum, Fachkräfte für die Wasserstoffbranche zu gewinnen und zu qualifizieren. "Technologische Souveränität braucht Menschen, die sie möglich machen", so Michaelis.