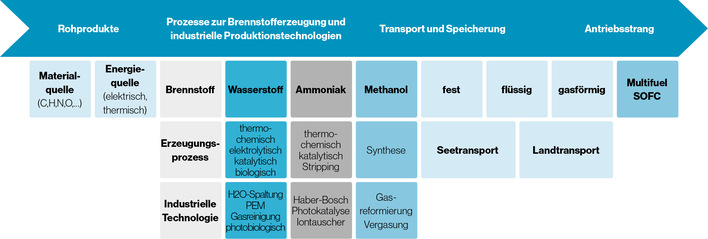Bundesregierung verabschiedet Kraftwerksstrategie
Das Ziel der Kraftwerksstrategie ist, dass die Versorgung mit Strom „auch in Zeiten mit wenig Sonne und Wind klimafreundlich gewährleistet“ ist, damit sie „einen wichtigen Beitrag zur Systemstabilität leisten“ kann. Elementare Voraussetzung dafür ist jedoch, dass der Ausbau der erneuerbaren Energien und der Stromnetze konsequent fortgesetzt wird, damit die Dekarbonisierung vorangetrieben werden kann.
Um dies zu erreichen, verständigten sich Bundeskanzler Olaf Scholz, Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck und Bundesfinanzminister Christian Lindner auf wesentliche Elemente. So soll beispielsweise ein vorgezogener Zubau von Kraftwerken angereizt werden. Die Ausschreibungen im Rahmen der Kraftwerksstrategie werden dafür so ausgestaltet, dass die neuen Kraftwerke in den zukünftigen Kapazitätsmechanismus vollständig integriert werden.
„Die Kraftwerksstrategie beschreibt, wie wir neue Kraftwerkstypen, die wasserstofffähig sind, in den Markt bringen werden.“
Robert Habeck, Bundesminister für Wirtschaft und Klimaschutz
Dafür sollen kurzfristig neue Kapazitäten (Gaskraftwerke, die H2-ready sind und an systemdienlichen Standorten stehen) mit einer Leistung von insgesamt 10 GW ausgeschrieben werden. Habeck hatte zuvor mehr als doppelt so viel anvisiert. Spätestens ab 2040 sollen diese dann vollständig von Erdgas auf Wasserstoff umgestellt werden. Kraftwerke, die ausschließlich mit Wasserstoff laufen, werden bis zu 500 MW im Rahmen der Energieforschung gefördert. Die dafür benötigten Fördergelder sollen aus dem Klima- und Transformationsfonds kommen. Außerdem sollen die Arbeiten an einem zukünftigen Strommarktdesign weiter vorangebracht werden.
Bestehende Hemmnisse bei der Errichtung und dem Betrieb von Elektrolyseuren sollen abgebaut werden. Zudem sollen alle Möglichkeiten genutzt werden, um insbesondere den Zubau von Elektrolyseuren, die systemdienlich betrieben werden sollen, zu beschleunigen. Darüber hinaus sollen Doppelbelastungen in Form von Abgaben und Gebühren, die bislang beim Betrieb von Elektrolyseuren anfallen, beseitigt werden. Konkret heißt es dazu: „Die Nutzung von Überschussstrom wird uneingeschränkt ermöglicht; alle bestehenden regulatorischen Hürden werden so weit wie möglich abgebaut.“
Kritik vom DWV
Die ersten Reaktionen aus der Energiebranche waren insgesamt positiv. Der DWV begrüßte ausdrücklich, dass sich die Bundesregierung jetzt auf wesentliche Elemente einer Kraftwerksstrategie geeinigt hat, da die Zeit erheblich dränge. Gleichzeitig kritisierte der Vorstandsvorsitzende Werner Diwald aber: „In der Analyse des BMWK heißt es, dass bis 2030 über 23 GW an Gaskraftwerken, die mit Wasserstoff betrieben werden können, zur Absicherung der Stromversorgung erforderlich sind. Es stellt sich daher die Frage, warum in der Eckpunkte-Vereinbarung zur Kraftwerksstrategie nur insgesamt 10,5 GW an Kraftwerksleistung ausgeschrieben werden sollen.“ Der DWV fordert die Ausschreibung der bereits seit langem angekündigten 8,8 GW in Form von Hybrid- und Sprinterkraftwerken sowie weitere 15 GW an zukunftsfähiger H2-Kraftwerksleistung, die in den nächsten drei Jahren ausgeschrieben werden sollen. Auch für den DVGW ist die jetzt angepeilte Kapazität „bestenfalls ein erster Schritt“.
„Bis 2030 sollen 80 Prozent des in Deutschland verbrauchten Stroms aus erneuerbaren Energien stammen.“
BMWK