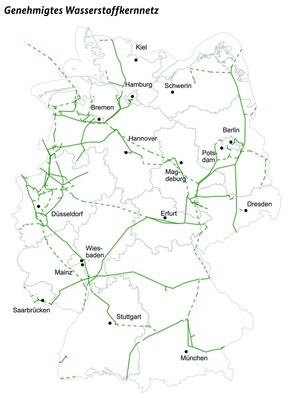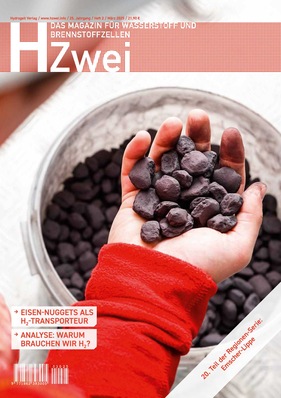Die Grundidee ist schon alt: Solarenergie aus der Sahara wird nach Europa exportiert, um die dortigen Energieprobleme zu lösen. Ist dies aber tatsächlich ein gangbarer Weg? Ökologisch betrachtet könnte dieses Projekt sinnvoll sein, weil dadurch fossile Energieressourcen geschont werden, aber ist es auch moralisch vertretbar, oder wäre dies eine neue Art des Kolonialismus? Und wie viel Arbeit und Geld müssten investiert werden und wie hoch sind die Transportverluste?
Bereits im Jahr 1982 spielte der Visionär Ludwig Bölkow mit diesem Gedanken, der dann später von der Ludwig-Bölkow-Systemtechnik GmbH aufgegriffen und um Wasserstoff erweitert wurde. Der Club of Rome übernahm die Idee, und nach der Jahrtausendwende führte das DLR Studien zu diesem Thema durch, auf denen dann später die Gründung von Desertec basierte.
Zunächst wurde die Desertec-Foundation formiert. Unabhängig davon gründete sich am 16. Juli 2009 eine Desertec-Initiative, ein Industriekonsortium aus vorrangig deutschen Firmen. Deren Versuch, im Rahmen von Desertec 1.0 solarthermische Kraftwerke in Nordafrika aufzubauen und Solarenergie per Hochleistungsstromnetz nach Europa zu transportieren, scheiterte jedoch, weil die afrikanischen Länder viel zu wenig involviert wurden.
Desertec 2.0 nahm dann die lokalen Märkte stärker in den Fokus, während das heutige Bündnis von Desertec 3.0 in den MENA-Wüsten nun Wasserstoff für die lokale Bevölkerung sowie für die globalen Märkte vorsieht.
Die Meinungen dazu gehen auseinander: Jorgo Chatzimarkakis forderte vor Jahren dezidiert Wasserstoffleitungen, die das Gas aus Afrika nach Mitteleuropa transportieren, und erklärte: „Wir werden ein Importland von erneuerbaren Energien, aber ein Exportland von Elektrolyseuren sein.“ Demgegenüber sagte Carsten Körnig, erneuerbare Energien in großer Menge zu importieren werde nicht möglich sein, weil auch andere europäischen Länder Bedarfe anmelden würden. Deswegen, so der BSW-Solar-Vorsitzende, solle verstärkt auf inländische Ökostromerzeugung gesetzt werden.
Um etwas mehr über den aktuellen Stand dieses Vorhabens zu erfahren, befragte HZwei Cornelius Matthes, den CEO von Dii Desert Energy.
In den gelben Ländern gibt es schon Projekte, in den grauen nicht. Gelber Wasserstoff wird via Thermolyse aus Müll gewonnen. Das ist speziell für Ägypten (aber auch Oman) relevant.
HZwei: Herr Matthes, Sie sagen in Vorträgen und Veröffentlichungen, dass die Unternehmen aus dem Desertec-Umfeld noch in diesem Jahrzehnt die Wasserstoffmengen liefern können, die Europa benötigt. Das klingt sportlich. Was ist die Grundlage für Ihre Zuversichtlichkeit?
Matthes: Wir kennen die Ankündigungen und Pläne unserer Partner. Dazu gehören Projekte wie Neom Green Hydrogen, das alleine 650 Tonnen Wasserstoff täglich produzieren soll, aber auch weitere Projekte von ACWA Power, Masdar, DEME, Linde oder EDF. Das sind große Unternehmen, deren Trackrecords zeigen, dass sie solche Projekte stemmen können. Rechnet man die Projekte zusammen, die bereits zwischen Ankündigung und der Umsetzungsplanung sind, kommt man auf mehr als die 10 Millionen Tonnen pro Jahr, die Europa bis 2030 importieren möchte. Mit dem Hydrogen Accelerator im Rahmen des REPowerEU-Plans sind die Produktions- und Importziele für Europa ungefähr vervierfacht worden. Das heißt, aus der 2x40-GW-Initiative, die wir Frans Timmermans im April 2020 gemeinsam mit unserem Partner Hydrogen Europe vorstellten, ist eine 2x160-GW-Initiative geworden. Die MENA-Region wird also bis Ende des Jahrzehnts den Wasserstoff liefern können, den Europa braucht.
Die Produktionskapazitäten sind das eine. Damit der grüne Wasserstoff eine Alternative zum fossilen Wasserstoff oder zu anderen Energieträgern wird, muss er aber auch bezahlbar sein.
Unser CTO Fadi Maalouf hat Modelle entwickelt, um die Kosten von Wasserstoff, E-Fuels und Ammoniak zu kalkulieren. Darin fließen auch die angekündigten H2-Gestehungskosten der Projekte ein, die für die kommenden Jahre geplant sind. Neom will Wasserstoff ab 2026 für rund 1,5 US-$ pro Kilogramm produzieren. Das ist sehr ambitioniert. In Marokko wären laut unserem Modell Kosten unter 2 US-$ pro Kilogramm möglich, in Ägypten könnte es etwas mehr sein. Insgesamt gehen wir aber davon aus, dass es viele Standorte in der MENA-Region gibt, die Mitte der 2020er-Jahre Wasserstoff für 1,50 bis 2,50 US-$ pro Kilogramm erzeugen können.
Dann ist der Wasserstoff aber immer noch in Nordafrika. Auf welchem Wege und zu welchen Kosten kommt er nach Europa?
Die Transportkosten per Schiff inklusive Umwandlung liegen nach unserer Schätzung bei 1 bis 2 US-$ pro Kilogramm. Mit einer Pipeline würde es deutlich billiger. Kalkuliert man mit einer neuen Pipeline, die Wasserstoff von Ägypten, Saudi-Arabien und Jordanien über das östliche Mittelmeer transportiert und in das geplante europäische Hydrogen-Backbone-Netz einspeist, lägen die Transportkosten um 50 US-Cent pro Kilogramm, wenn man es auf die gesamte Lebensdauer der Pipeline, inklusive Capex und Opex, umlegt. Mit niedrigen Erzeugungskosten, wie bei Neom vorgesehen, oder auch bei späteren Projekten wird es also möglich werden, Wasserstoff für 2 US-$ bis nach Zentraleuropa zu bringen.
Die Daten hierzu stammen von Branchen-Insidern aus der Öl- und Gaswirtschaft wie dem King Abdullah Petroleum Studies and Research Center (KAPSARC) oder ILF Beratende Ingenieure. ILF hat schon einige Pipelines in der Region geplant und kann so realistische Annahmen für die Kosten treffen. Auch eine mögliche Trassenführung ist schon recht gut untersucht.
Wäre es nicht einfacher, bestehende Pipelines umzuwidmen oder den Wasserstoff beizumischen?
Es gibt parallele Initiativen, um bestehende Leitungen umzuwidmen und zum Beispiel Wasserstoff aus Marokko nach Spanien zu bringen. Aber schon allein die aktuellen Lieferbeziehungen sind politisch sehr kompliziert: Normalerweise fließt das Gas aus Algerien durch Marokko und die Meerenge von Gibraltar nach Spanien. Doch Algerien hat die diplomatischen Beziehungen zu Marokko abgebrochen und im November 2021 auch die Gaslieferungen gestoppt, so dass Marokko von der direkten Gaslieferung abgeschnitten ist. Stattdessen kommt nun algerisches Gas zuerst nach Europa und dann über Spanien nach Marokko. Gleichzeitig soll Algerien ja eigentlich gerade mehr Erdgas nach Europa liefern.
Auch die Beimischung von Wasserstoff in die Erdgasleitungen wird voraussichtlich keine große Rolle spielen. Das Erdgas würde dadurch zwar etwas „grüner“, aber der eigentliche Wert des flexiblen Rohstoffs Wasserstoffs ginge verloren. Deshalb ist die Transportform wenig attraktiv.
Das klingt nach einem Selbstläufer. Können wir uns die Milliardenzuschüsse für die Wasserstoffwirtschaft also sparen?
Ohne politische Unterstützung wird es nicht gehen. Vor allem muss Europa für einen sicheren Bedarf an grünem Wasserstoff sorgen, um die Projekte wirtschaftlich attraktiv zu machen – das alles mithilfe einer klaren Regulierung sowie international gut abgestimmter Zertifizierung. Der aktuelle Delegated Act ist eher ein Beispiel dafür, wie man die notwendige Entwicklung verzögern kann. Länder wie Indien agieren hier deutlich pragmatischer. Auch die Länder entlang der Strecke müssten im Boot sein, insbesondere Griechenland, wo die Pipeline anlanden würde, und Italien. Es wären Garantien und Private Public Partnerships nötig. Viele Gespräche dazu laufen schon, und ich denke, die Klimakonferenz COP27 im November wird weitere Fortschritte bringen. Klar ist: Die großen Infrastrukturthemen müssen auf die politische Agenda – das passiert nicht von alleine.
So etwas kann dauern. Wie kommt der Wasserstoff in den nächsten Jahren nach Europa?
Pipelines, Ammoniak und E-Fuels sind alle Technologien für dieses Jahrzehnt. Neben Pipelines ist die am weitesten entwickelte Technologie definitiv Ammoniak. Es gibt weltweit über hundert Schiffe, die es transportieren können, viele Import- und Exportterminals und auch eine Speicherinfrastruktur. Für den direkten Einsatz in der Chemieindustrie, zum Beispiel bei Covestro oder BASF sowie der Düngemittelindustrie, ist das ideal. Ans Limit gerät die Technologie, wenn man das Ammoniak in Wasserstoff zurückwandeln will. Das Cracken ist energieintensiv und noch nicht großindustriell etabliert.
LOHC, also Liquid Organic Hydrogen Carriers, haben auch eine Chance, ihr Erfolg hängt allerdings noch von vielen offenen Fragen ab. Flüssigwasserstoff wird in dieser Dekade dagegen keine Rolle spielen. Die Technologie ist noch nicht reif für die Massenproduktion. Das Testschiff von Kawasaki hat gezeigt, dass noch eine anspruchsvolle Entwicklung vieler Bauteile nötig ist. In den 2030ern könnte flüssiger Wasserstoff aber wichtiger werden.
Der studierte Betriebswirt Cornelius Matthes ist seit 2010 im Managementteam der Desertec Industrial Initiative (Dii) aktiv und seit Januar 2021 CEO von Dii Desert Energy. Er begann seine berufliche Laufbahn in der Deutsche Bank Gruppe. Für den italienischen Projektentwickler Building Energy baute er ab 2013 als Managing Director MENA (Middle East and North Africa = Nahost und Nordafrika) einen neuen Standort in Dubai auf. Seit 2016 gründete er zudem mit verschiedenen Partnern eigene Projektentwicklungs- und Investitionsgesellschaften für erneuerbare Energien. Matthes berät Erneuerbare-Energien-Unternehmen und Investmentfonds, ist Gastdozent an verschiedenen Universitäten und wurde als Solar Pioneer 2015 ausgezeichnet.
Interviewerin: Eva Augsten