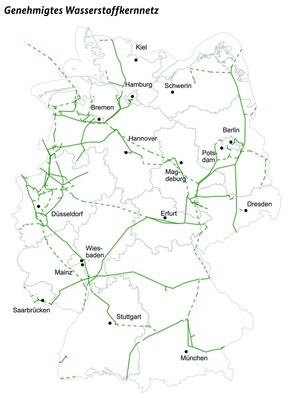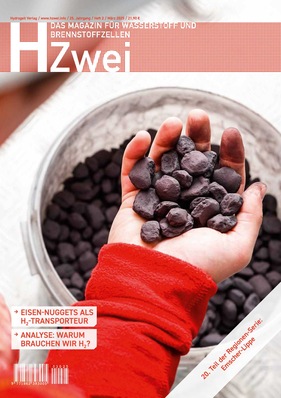Der Markthochlauf der Elektrolyse ist ein entscheidender Engpass für die Massenproduktion von grünem Wasserstoff. In einem kürzlich erschienenen Artikel in Nature Energy haben wir mögliche Ausbaupfade der Elektrolysekapazität in der Europäischen Union und global (Odenweller et al., 2022) analysiert. Mithilfe eines Technologiediffusionsmodells zeigen wir, dass der Markthochlauf trotz anfänglich exponentiellen Wachstums Zeit braucht. Selbst wenn die Elektrolyse so schnell wächst wie Photovoltaik und Windenergie – die bisherigen Wachstumschampions – bleibt die Verfügbarkeit von grünem Wasserstoff kurzfristig knapp und langfristig unsicher. Trotzdem ist es wichtig, den Markthochlauf jetzt zu beschleunigen, um die Erreichung der ambitionierten 2030-Ausbauziele sowie die langfristige Verfügbarkeit sicherzustellen.
Als Schlüsseltechnologie für die Produktion von grünem Wasserstoff stellt der Markthochlauf der Elektrolysekapazität einen entscheidenden Engpass dar (IRENA, 2020). Die Dimensionen der benötigten Skalierung sind enorm, da Ende 2021 weltweit nur rund 600 MW Elektrolysekapazität im Betrieb waren. Um die laut IEA für die Klimaneutralität benötigten 3.670 GW in 2050 zu erreichen, muss die Kapazität daher um das 6.000-Fache anwachsen (IEA, 2022b), was den gleichzeitig benötigten zehnfachen Ausbau der Kapazität erneuerbarer Energien klar in den Schatten stellt.
Der Ausbau der Elektrolyse repräsentiert darüber hinaus auch die koordinative Herausforderung, nicht nur das Wasserstoffangebot, sondern auch die Wasserstoffnachfrage und -infrastruktur gleichzeitig hochzufahren – das sprichwörtliche „dreiseitige Henne-Ei-Problem“ des H2-Markthochlaufs (Schulte et al., 2021).
Im Folgenden fassen wir die Kernergebnisse unseres kürzlich erschienenen Artikels zum Elektrolysemarkthochlauf zusammen (Odenweller et al., 2022). Dabei zeigen wir aktualisierte Daten und Ergebnisse auf Basis der aktuellsten Version der IEA Hydrogen Projects Database vom Oktober 2022 (IEA, 2022a).
Angekündigte Elektrolyseprojekte
In den kommenden Jahren zeichnet sich eine ausgeprägte Dynamik der Projektankündigungen ab (s. Abb. 1). Bei vollständiger Realisierung aller angekündigten Projekte würde die Elektrolysekapazität in der EU 2024 verglichen mit 2021 um einen Faktor 28 ansteigen, global um einen Faktor 23. Dieser positive Ausblick steht jedoch unter dem Vorbehalt, dass für über 80 Prozent dieser Projektankündigungen noch keine endgültige Investitionsentscheidung getroffen wurde. Somit besteht erhebliche Unsicherheit über die kurzfristige Projektrealisierung und daher auch darüber, ob rechtzeitig ausreichend grüner Wasserstoff für die Klimaneutralität zur Verfügung stehen wird.
Im Hauptszenario unseres Artikels stellen wir daher die Frage: „Was wäre, wenn die Elektrolyse so schnell wächst wie die Photovoltaik oder Windenergie in ihrer jeweiligen Boomphase?“ Um unvermeidbare Unsicherheiten abzudecken, benutzen wir ein Modell, mit dem wir die Technologiediffusion von Elektrolyseuren unter Tausenden von verschiedenen Parameterkonstellationen simulieren und anschließend aggregieren (s. Kasten).
Für den Fall, dass die Elektrolysekapazität so schnell wächst wie einst Photovoltaik und Windenergie – die bisher größten Erfolgsgeschichten der Energiewende –, kann das Kernergebnis zusammengefasst werden als: Kurzfristige Knappheit, langfristige Unsicherheit.
Methodik: Technologiediffusionsmodell
Neue Technologien durchdringen Märkte in der Regel in Form einer S-Kurve. Dabei folgt auf ein anfänglich exponentielles Wachstum ein annähernd linearer Anstieg in der Wachstumsphase, bevor sich das Wachstum in der Sättigungsphase abschwächt und dem Maximum annähert. In unserem Artikel erweitern wir dieses Standardmodell der Technologiediffusion um eine stochastische Unsicherheitsanalyse. Als unsichere Parameter betrachten wir (i) die Elektrolysekapazität in der nahen Zukunft, konkret im Jahr 2024, (ii) die anfänglich exponentielle Wachstumsrate und (iii) die Nachfrage nach grünem Wasserstoff, für die wir einen stetigen Anstieg, basierend auf politischen Zielen und Klimaneutralitätsszenarien, annehmen. Aus der gemeinsamen Fortpflanzung dieser unabhängigen Unsicherheiten ergibt sich schließlich das, was wir als „probabilistischen Möglichkeitsraum“ bezeichnen.
Kurzfristige Knappheit
Selbst bei Wachstumsraten wie bei Photovoltaik und Windenergie bleibt die Elektrolysekapazität und damit auch das Angebot an grünem Wasserstoff noch ein bis zwei Jahrzehnte knapp. Dies gilt sowohl im Vergleich zu den kurz- und mittelfristigen Ausbauzielen als auch im Vergleich zur Größe des gesamten Energiesystems. Insbesondere das Ziel der EU, bis 2030 jährlich 10 Millionen Tonnen erneuerbaren Wasserstoff herzustellen, was etwa 100 GW Elektrolysekapazität erfordert, ist unter diesen Wachstumsraten nicht erreichbar. Das Gleiche gilt für die laut IEA bis 2030 benötigten 720 GW globaler Elektrolysekapazität im ambitionierten NZE-Szenario (IEA, 2022b).
In Relation zum gesamten Energiesystem heißt das, dass, selbst wenn die Elektrolyse so schnell wächst wie Photovoltaik und Windenergie, grüner Wasserstoff in der EU bis 2030 und global bis 2035 wahrscheinlich nur weniger als ein Prozent der jeweiligen Endenergienachfrage decken kann.
Langfristige Unsicherheit
In der langfristigen Perspektive zeigt sich, dass ein Durchbruch zu großen Elektrolysekapazitäten möglich ist und immer wahrscheinlicher wird. Jedoch sind der Zeitpunkt und das Ausmaß dieses Durchbruchs mit erheblichen Unsicherheiten behaftet.
Für den Fall von Wachstumsraten im Bereich von Photovoltaik und Windenergie findet der Durchbruch in der EU im Durchschnitt um das Jahr 2038, global erst um das Jahr 2045 statt. Angesichts der aktuell großen Euphorie rund um das Thema Wasserstoff mag dies erstaunen. Allerdings braucht es bei einem sehr kleinen Anfangswert schlicht eine lange Zeit, bis sich die hohen relativen Wachstumsraten auch in hohe absolute Kapazitäten übertragen.
Wachstum unter Notfallmaßnahmen
Unser Artikel beschreibt eine wertfreie Wenn-dann-Analyse unter der zentralen Annahme, dass die Elektrolysekapazität so schnell wächst wie Photovoltaik und Windenergie. Im Anhang des Artikels präsentieren wir eine Liste mit Pro- und Kontra-Argumenten zur Frage, ob die Elektrolyse schneller wachsen könnte als diese erfolgreichen Technologien.
Um zu untersuchen, was unter besonderen Umständen möglich wäre, stellen wir daher auch die Frage: „Was wäre, wenn die Elektrolyse so schnell wächst wie Technologien mit den historisch höchsten Wachstumsraten?“ Dafür betrachten wir die Wachstumsraten eines sehr heterogenen Datensatzes, von US-Militärproduktion über den Ausbau des chinesischen Hochgeschwindigkeitszugnetzes bis hin zur Marktdiffusion von Internethosts und Smartphones. Es zeigt sich, dass nur mit solch ungewöhnlich hohen Wachstumsraten das Wasserstoffziel der EU für 2030 in Reichweite bleibt und damit auch langfristig die Lücke zwischen möglichem Angebot und potenzieller Nachfrage nach Wasserstoff geschlossen werden kann.
Politische Implikationen
Derart hohe Wachstumsraten werden nur mit besonderer politischer Koordinierung, Regulierung und Finanzierung erreicht werden können. Entsprechende Politikmaßnahmen müssen die Wirtschaftlichkeit von privaten Wasserstoffinvestitionen absichern, beispielsweise durch öffentliche Ko-Finanzierung oder direkte Regulierung wie Quoten für grünen Wasserstoff. Darüber hinaus erfordert der gleichzeitige Markthochlauf von Angebot, Nachfrage und Infrastruktur erhebliche Koordinierung.
Mit den europäischen IPCEI-Wasserstoffprojekten, der geplanten EU Hydrogen Bank sowie dem US Inflation Reduction Act haben die zwei größten Volkswirtschaften der Welt kürzlich neuen Schwung in die Förderung von Wasserstoff gebracht. Es bleibt allerdings abzuwarten, ob diese Maßnahmen ausreichen, um den Teufelskreis aus unsicherem Angebot, unzureichender Nachfrage und unvollständiger Infrastruktur zu durchbrechen.
Solange sowohl die Verfügbarkeit als auch die Kosten von grünem Wasserstoff unsicher sind, sollten sich politische Entscheidungsträgerinnen über das Risiko im Klaren sein, das Potenzial von Wasserstoff zu überschätzen. Falls das zukünftige Wasserstoffangebot die Erwartungen übersteigt, wird es unproblematisch sein, Anwendungen für diesen zu finden. Im umgekehrten Fall, falls das Wasserstoffangebot hinter den Erwartungen zurückbleibt, wird es jedoch für viele Anwendungen zu spät sein, um für die Klimaneutralität noch rechtzeitig zu Alternativen zu wechseln.
Es bleibt ein politischer Drahtseilakt: Einerseits muss der Markthochlauf von grünem Wasserstoff erheblich beschleunigt werden. Andererseits dürfen die damit einhergehenden Erwartungen nicht den notwendigen Markthochlauf von bereits verfügbaren und effizienteren Alternativen der direkten Elektrifizierung, wie Wärmepumpen und Elektroautos, ausbremsen.
Diese Studie des PIK wurde schon im Februar 2022 auf der H2-Kompass-Konferenz in Berlin präsentiert, worüber auch bereits im HZwei-April-Heft 2022 berichtet wurde. Da die dargelegten Erkenntnisse in den Medien teils zu übertriebenen Schlagzeilen geführt haben, werden hier die Kernelemente nochmals etwas ausführlicher dargelegt.
Literatur:
IEA. (2022a). Hydrogen Projects Database. https://www.iea.org/data-and-statistics/data-product/hydrogen-projects-database
IEA. (2022b). World Energy Outlook 2022. https://www.iea.org/reports/world-energy-outlook-2022
IRENA. (2020). Green hydrogen cost reduction: Scaling up electrolysers to meet the 1.5°C climate goal. International Renewable Energy Agency. https://www.irena.org/publications/2020/Dec/Green-hydrogen-cost-reduction
Odenweller, A., Ueckerdt, F., Nemet, G. F., Jensterle, M., & Luderer, G. (2022). Probabilistic feasibility space of scaling up green hydrogen supply. Nature Energy, 7(9), Art. 9. https://doi.org/10.1038/s41560-022-01097-4
Schulte, S., Sprenger, T., & Schlund, D. (2021). Perspektiven auf den Wasserstoffmarkthochlauf: Stakeholderanalyse mit Fokus Deutschland (EWI Policy Brief).
Autoren:
Adrian Odenweller
adrian.odenweller@pik-potsdam.de
Dr. Falko Ueckerdt
falko.ueckerdt@pik-potsdam.de
beide vom Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung